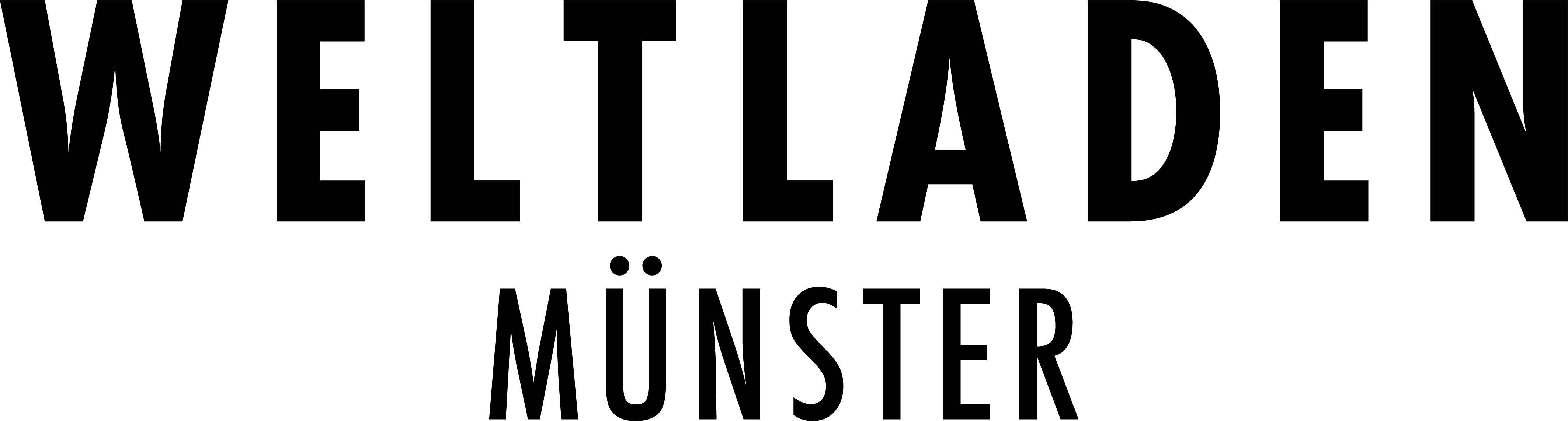Ulrich Wegst hat ein nicht ganz kantenfreies Buch über die Kulturtechnik des Verzichtens geschrieben
Ulrich Wegst hat ein nicht ganz kantenfreies Buch über die Kulturtechnik des Verzichtens geschrieben
Das Sprichwort weiß es längst: Weniger ist manchmal mehr. Und nach Lektüre von Ulrich Wegst Buch ließe sich ergänzen: Weniger ist der Schlüssel zum Überleben. Und zwar der Menschheit. So in etwa ließe sich die Pointe von Keine Angst vorm Verzicht reformulieren, in dem Wegst das Verzichten zur wichtigsten Kulturtechnik des noch jungen Jahrhunderts erhebt und zu einem Parforceritt durch nahezu alle gesellschaftlichen Felder ansetzt, um Bedeutung und Notwendigkeit des Weniger auszuloten. Die existentielle Dimension dieses Ansatzes ist, so der Autor, dabei nicht von der Hand zu weisen. Die Dringlichkeit des Verzichtens steht mit Blick auf überfischte Meere, überdüngte Böden, dem geradezu rauschhaften Einsatz von Pestiziden und Insektiziden aller Art, dem massenhaften Wegsterben von Flora und Fauna, dem Abholzen der Wälder und dem sich bedrohlich erwärmenden Klima außer Frage. Die planetaren Grenzen sind uns in den vergangenen Jahren mit zunehmender Geschwindigkeit näher gerückt, der Klimawandel ist endgültig in den Zustand des Akuten getreten und wird nur noch von beinharten Kapitalisten und Populisten geleugnet (wenn auch seine Verharmlosung in nahezu allen politischen Lagern festzustellen ist). Das lässt sich nicht zuletzt im Aufkommen neuer politischer Akteure und einer Vielzahl an Veröffentlichungen zu diesem Themenbereich festmachen. Der oft geäußerten Einsicht, dass es so nicht weitergehen könne, steht allerdings der Umstand entgegen, dass sich in der Lebensführung der Mehrheit aller Deutschen (und damit letztlich der Mehrheit aller Bewohner des überindustrialisierten globalen Nordens) nichts geändert hat. Hier gilt auch weiterhin die Prämisse: Je mehr, desto lieber. Verzichten liegt uns nicht und Wegst zählt eine ganze Reihe biologischer, sozialer, ökonomischer wie politischer Gründe auf, warum es uns so schwer fällt, ein einmal erreichtes Konsumniveau wieder aufzugeben.
Er benennt in gebührender Deutlichkeit diese gesellschaftlichen Fehlentwicklungen und ihre für Klima, Umwelt, aber eben auch für unsere eigene Gesundheit mitunter verheerenden Wirkungen. Dabei plädiert er, trotz des Umstandes, dass sich die Einsicht in die Begrenztheit natürlicher Ressourcen seit Jahrzehnten nicht in entsprechendes politisches Handeln umgeformt hat, gerade für mehr Demokratie, vor allem für mehr direkte Demokratie – der einzige Bereich, an dem uns Verzicht nicht weiterbringt. Der Frage, wie sich notwendige Verzichtsleistungen in politische Mehrheiten umsetzen lassen, ist auch deswegen von so großer Bedeutung, weil Wegst sich für eine Renaissance der Ordnungspolitik ausspricht, sprich für den Gottseibeiuns des politischen Betriebs: das Verbot. Wer aber glaubt, ohne Verbote auszukommen (und sich stattdessen Begriffe wie Innovation auf die Fahnen schreibt), oder sich auf die Selbstregulierungskräfte des Marktes verlässt, der umgeht das Problem schlicht und hält am Bild des Bürgers als Konsumenten fest, dem man bittere Wahrheiten nicht zumuten könne. Dieser Vagheit und Zagheit des Sprechens fühlt sich Wegst selbst nicht verpflichtet und geißelt in erfrischender Deutlichkeit alle Bemühungen, gesamtgesellschaftliche Reduktionsleistungen zu verhindern und ihre Notwendigkeit zu bestreiten – wobei sein Hang zur Polemik nicht selten in Rechthaberei und Oberlehrertum kippt.
Besonders heftig schlägt er sprachlich aber dort um sich, wo sich zunächst vermeintliche Koalitionen und Allianzen vermuten ließen. Mag seine Ablehnung religiös motivierten Verzichts sowie der Entschleunigungsindustrie noch verständlich sein (für ihn alles ideologisch durchdrungen), so sind seine Auslassungen gegen die Postwachstumsökonomie von unnötiger Heftigkeit – und fallen noch dazu häufig einseitig bis verzerrend aus. Das mag auch daran liegen, dass sich Wegst mit der Lektüre von nicht einmal einer Handvoll Texten begnügt und die mittlerweile existierende Forschungslandschaft vollständig ausblendet. Nicht zuletzt wird man den Eindruck nicht los, dass sich seine Kritik an den Protagonisten einer Postwachstumsökonomie – für Wegst wenig mehr als ein Ablenkungsmanöver versehen mit „paternalistischer Arroganz“ – zu stark an den strukturellen Vorgaben jenes ökonomischen Ist-Zustandes orientiert, den es gerade zu überwinden gilt. Tatsächlich markiert die Systemfrage eine Leerstelle in Wegst Buch; sie wird zu keinem Zeitpunkt formuliert. Seine Kritik an einer Ökonomie, die uns an die Grenzen des planetaren Kollaps gebracht hat, kommt ohne eine dezidierte Kritik des Kapitalismus daher und bleibt dementsprechend für dessen Herrschaftsverhältnisse blind. Politische Kampfbegriffe sind, trotz aller verbalen Ohrfeigen, die Wegst verteilt, nicht seine Sache. Er ist ein nüchterner Pragmatiker, der den Weg in den Verzicht nicht durch die damit eventuell zu bewerkstelligende „Befreiung vom Überfluss“ (Niko Paech) zu motivieren versucht, sondern darauf setzt, wir würden diesen Schritt letztlich „schlicht aus Einsicht in die Notwendigkeit“ gehen. Dass diese Einsicht mitunter erst durch zivilgesellschaftliche Akteure vorbereitet und hervorgebracht wird, für die Wegst in seinem Buch häufig nur ein müdes Lächeln übrig hat, zeigt die Grenzen seines pragmatischen Blickes auf. Trotzdem: Er hat ein über weite Strecken kluges Buch geschrieben, das reichlich Reibungsfläche bietet und verdeutlicht, dass wir auf eine Diskussion über den Verzicht nicht verzichten können.
© Manuel Förderer
Ulrich Wegst: Keine Angst vorm Verzicht. Ein Plädoyer für die wichtigste Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts, Büchner Verlag, Marburg 2021, 200 Seiten, 18 €