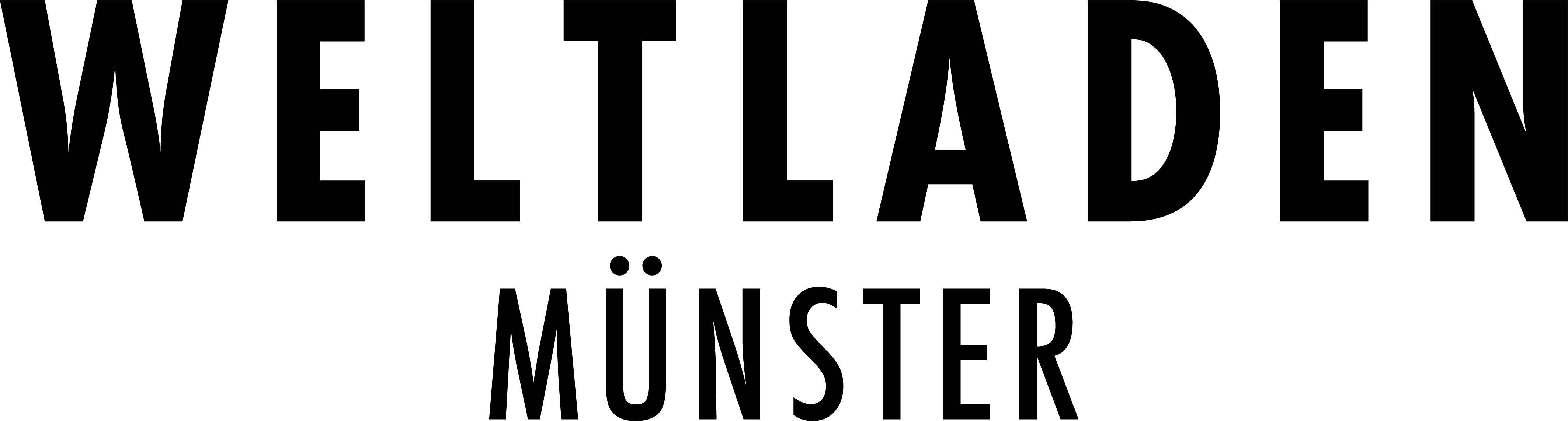Andreas Wagner erzählt in seinem Debütroman eine Familiengeschichte in und um den Hambacher Forst
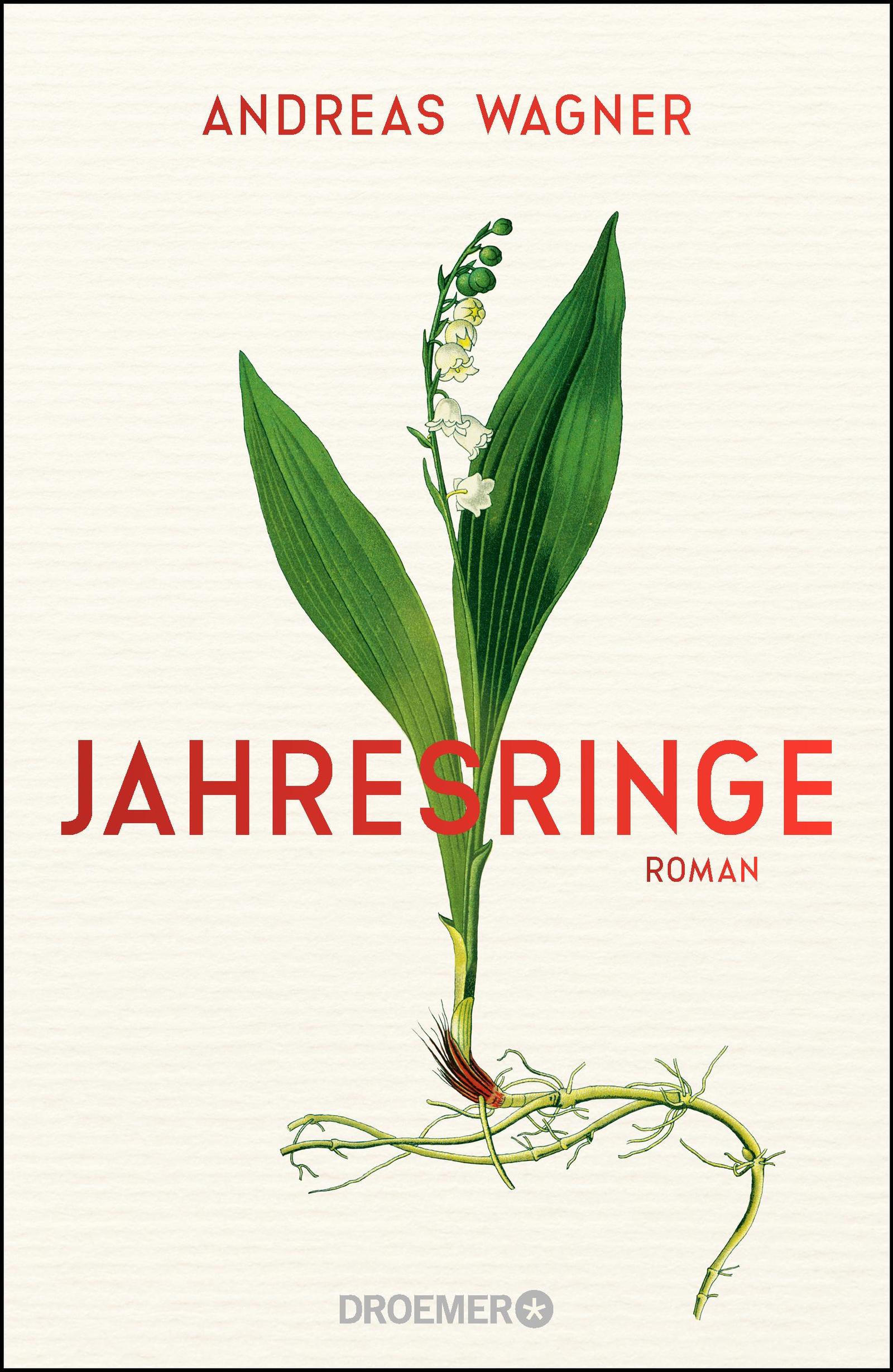 Der Wald spielt im kulturellen Selbstverständnis der Deutschen seit jeher eine besondere Rolle. In ihm bündeln und konzentrieren sich nicht nur eine Vielzahl ökonomischer Interessen, er ist vor allem Ort magisch-mythischer sowie märchenhafter Erzählungen. An ihm entzünden sich seit Jahrhunderten die Phantasien, die den Wald nicht zuletzt zum Rückzugsort all jener gesellschaftlicher Elemente stilisierten, für die zunehmend weniger Platz war oder die die Gesellschaft prinzipiell scheuten und scheuen mussten: von der sprichwörtlichen Hexe über die mal aus guten (Robin Hood), mal aus weniger guten Motiven agierenden Räuber bis hin zu all den imaginären Gestalten und Gespenstern, die die aufgeklärte Moderne aus ihren Reihen ausgeschlossen zu haben glaubte und die zwischen Buchen und Eichen fortexistierten. In diesen Figuren und im Wald als besonderem Raum bewahrten sich die Konturen einer Gegenkultur und exemplarischen Naturnähe, die vor allem die Romantiker beschworen und die aktuell – Trends wie das Waldbaden lassen es erahnen – offenbar wieder an Bedeutung gewinnen. Nicht zuletzt ist der Wald aber auch Teil jener Narrative nationaler Selbstermächtigung, wie sie die deutsche Geschichte bis in 20. Jahrhundert prägten; der Teutoburger Wald ist das klassische Beispiel dafür, wie aus einem Wald der so oft apostrophierte ‚deutsche‘ Wald wurde.
Der Wald spielt im kulturellen Selbstverständnis der Deutschen seit jeher eine besondere Rolle. In ihm bündeln und konzentrieren sich nicht nur eine Vielzahl ökonomischer Interessen, er ist vor allem Ort magisch-mythischer sowie märchenhafter Erzählungen. An ihm entzünden sich seit Jahrhunderten die Phantasien, die den Wald nicht zuletzt zum Rückzugsort all jener gesellschaftlicher Elemente stilisierten, für die zunehmend weniger Platz war oder die die Gesellschaft prinzipiell scheuten und scheuen mussten: von der sprichwörtlichen Hexe über die mal aus guten (Robin Hood), mal aus weniger guten Motiven agierenden Räuber bis hin zu all den imaginären Gestalten und Gespenstern, die die aufgeklärte Moderne aus ihren Reihen ausgeschlossen zu haben glaubte und die zwischen Buchen und Eichen fortexistierten. In diesen Figuren und im Wald als besonderem Raum bewahrten sich die Konturen einer Gegenkultur und exemplarischen Naturnähe, die vor allem die Romantiker beschworen und die aktuell – Trends wie das Waldbaden lassen es erahnen – offenbar wieder an Bedeutung gewinnen. Nicht zuletzt ist der Wald aber auch Teil jener Narrative nationaler Selbstermächtigung, wie sie die deutsche Geschichte bis in 20. Jahrhundert prägten; der Teutoburger Wald ist das klassische Beispiel dafür, wie aus einem Wald der so oft apostrophierte ‚deutsche‘ Wald wurde.
Nachdem die Wälder in der Literatur einiges an Bedeutungsverlust hinnehmen mussten, sind sie seit einigen Jahren wieder zurückgekehrt – was sicherlich auch mit dem allgemeineren gesellschaftlichen Interesse für Baum und Strauch zu tun haben mag. Kein anderer Wald jedoch hat in letzter Zeit für eine ähnliche mediale Mobilisierung gesorgt wie der Hambacher Forst. In dessen Nähe siedelt Andreas Wagner in seinem Romandebüt Jahresringe die Geschicke der kleinen Familie Klimkeit an, die der Text über drei Generationen von 1946 bis 2018 verfolgt und deren Leben aufs Engste mit dem Wald verbunden ist. Am Anfang steht das Auftauchen des aus Ostpreußen geflohenen Mädchens Leonore in einem kleinen Dorf des rheinischen Kohlereviers, das sich mit Mut und Zähigkeit seinen bis zuletzt gefährdeten Platz in einer auf alles Fremde mit Argwohn und Abscheu reagierenden Nachkriegsgesellschaft erkämpft. Die einzigen Kontakte innerhalb dieser, wie es der Historiker Andreas Kossert nannte, „kalten Heimat“ kann Leonore zu anderen Außenseiterfiguren herstellen, darunter der als Dorftrottel geduldete, der nationalsozialistischen Vernichtungsideologie mit Glück entronnene Harbinger Arnold, dessen Angewohnheit, sich in eingelernten Phrasen zu verständigen, die Dorfgesellschaft gleichermaßen irritiert wie beunruhigt – erinnert sie dieser Mensch doch an Verfehlungen, die man nur zu gerne der Vergangenheit und dem Vergessen übereignen würde.
Wagner erzählt mit großem Einfühlungsvermögen von dem harten und vor allem in emotionaler Hinsicht entbehrungsreichen Leben Leonores und nicht zuletzt vom Wald, dem Bürgewald, in den sich Leonore häufig zurückzieht, in dessen Weiten sie sich verliert und in dem sie – so viel sei verraten – selbst einem kleinen Wunder begegnet. Der Roman hat durchaus Raum für Phantastik und Märchenhaftes.
Die Verbindung von Familienchronik und Waldgeschichte, die bereits im Titel des Romans anklingt, intensiviert sich genau in jenem Moment, in dem diese Beziehung zu zerbrechen droht. Der Tagebau rückt an das Dorf heran, es soll umgesiedelt werden, und Wagner zeichnet nach, wie das Dorf zunächst den Kampf gegen das Unvermeidliche, das sich als Gemeinwohl tarnt, aufnimmt und schließlich daran zerbricht. Mit dem Wald ist zugleich das Dorf und seine gewachsenen sozialen Beziehungsstrukturen bedroht, wobei die damit einhergehenden Konfliktlinien mitunter direkt durch die Familien verlaufen. Die drohende Heimatlosigkeit durchzieht leitmotivisch den Roman und verknüpft die drei Generationen der Klimkeits in ihrem Ringen darum, einen Platz im Leben zu finden. Zugleich greift der Text jene gesellschaftlichen Diskurse auf, die mit dem Namen Hambacher Forst – jenem kümmerlichen Überrest des einstigen Bürgewalds – verbunden sind: die politischen Kämpfe zwischen wirtschaftlichen Interessen, Furcht vor Arbeitsplatzverlust, Klimaschutz-Aktivismus und dem Bemühen um den Erhalt eines Raumes, dessen Zerstörung durch keine Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren ist. Jahresringe ist damit nicht zuletzt eine Elegie, ein melancholischer Text, der unwiederbringliche Verluste thematisiert, seien es die soziale wie geographische Heimat, die Jugend, die Unschuld, bis zuletzt der Abgesang auf eine ganze Zeit angestimmt wird. Dabei zeigt gerade das Verweben von Gesellschafts- und Waldgeschichte, wie umsichtig dieser Roman komponiert ist. Er richtet den Fokus auf den offenbar verschütteten Umstand, dass es mitnichten egal ist, in welcher Umwelt wir leben, welche Räume uns umgebenen und ob es uns möglich ist, unsere eigene Geschichte in dieser Umgebung gespiegelt zu sehen. Man kann dem Roman durchaus vorwerfen, dass er vor allem gegen Ende hin zu viele Register zieht, seine Figuren moralisch zu sehr abdichtet und den Bereich des literarisch Wahrscheinlichen doch schon arg strapaziert. Gerade dort, wo Andreas Wagner sich nicht auf eigene Anschauung und Erfahrung verlassen kann, bei der Beschreibung der dörflichen Nachkriegsgesellschaft oder den Beatles-Jahren seiner Figur Paul, gerade dort gelingt es ihm am besten, überzeugend realitätsnah und emotional packend zu erzählen; die Abschnitte zu den Jahren 2017 und 2018 wirken dagegen ein wenig plakativ. Man wird allerdings leicht darüber hinwegsehen können, ist Wagner doch mit Jahresringe unterm Strich ein Roman geglückt, der den Wald und unser Leben mit ihm erneut dahin bugsiert, wo beide hingehören: ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Buch schließt in einer Manier, die hoffnungsvoll stimmt; der Kampf um jeden einzelnen Baum hat gerade erst begonnen.
© Manuel Förderer
Andreas Wagner: Jahresringe, Verlag Droemer Knaur, München 2020, 256 Seiten, 20 Euro