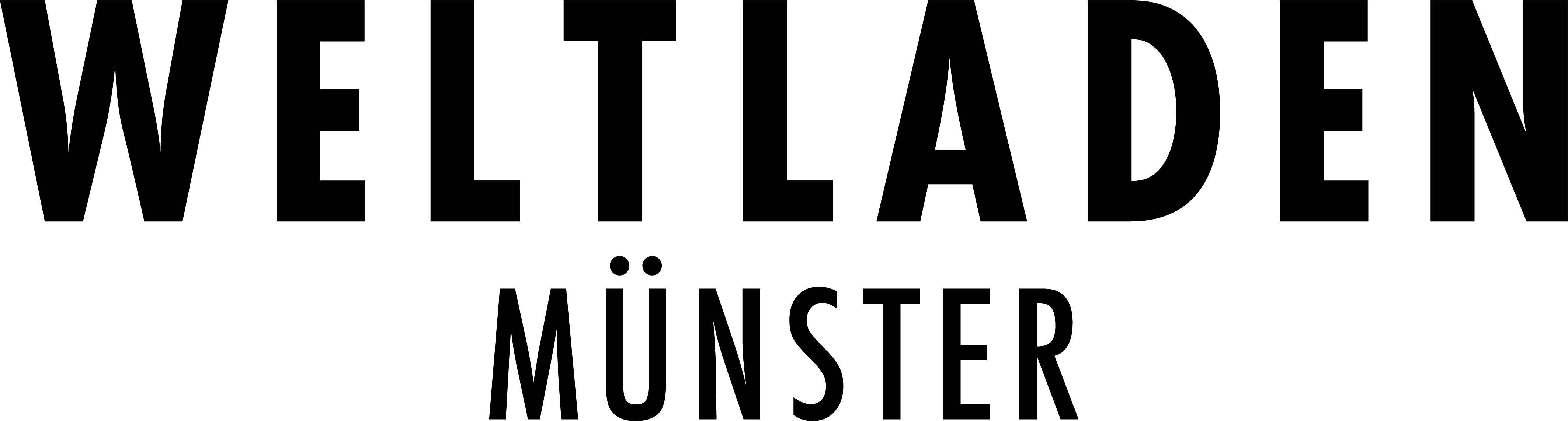Die Klassenfrage ist nicht zurückgekehrt – sie war nie wirklich weg
Die Klassenfrage ist nicht zurückgekehrt – sie war nie wirklich weg
Wer gerne Horror-Filme schaut (oder einen Hang zu Sigmund Freud hat), der weiß, dass sich nichts auf Dauer verdrängen lässt. Was man unter den Teppich kehrt, hat die unangenehme Eigenschaft wiederzukehren, ohne etwas von seinem anfänglichen Schrecken in der Zwischenzeit verloren zu haben. Die Klassenfrage ist ein solcher Wiedergänger unserer Gesellschaft, der vielleicht nicht mit Schrecken, aber von manchen doch zuweilen mit Verwunderung registriert wird. Klasse, das klingt nach marxistischer Mottenkiste, Begriffe wie Klassenkampf und Klassenzugehörigkeit wirken wie politische Pathosformeln aus dem vorigen Jahrhundert, die sich doch mit dem Gang der Geschichte erledigt haben. Adieu Sowjetunion, Adieu Systemalternative, sei willkommen klassenlose Wohlstandsgesellschaft. Wer so denkt, den kann auch die massive Ausweitung des Niedriglohnsektors innerhalb der vergangenen zwanzig Jahre kaum irritieren – wahrscheinlich, weil es ihn nicht betrifft.
Die vielbesungene „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“, die der Soziologe Helmut Schelsky bereits in den frühen 1950ern aufkommen sah, war augenscheinlich der Wunschtraum liberaler und konservativer Ökonomen. Durch typisch deutsche Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit und Fleiß habe sich ein breiter Mittelstandsteppich gebildet, der lediglich an den Rändern etwas nach oben und nach unten ausfranzt. Unten finden sich die ungebildeten, ungelernten und zumeist armen Malocher, oben die selbstverständlich durch eigene Anstrengung reich gewordenen Leistungsträger. Für Klasse war in einem solchen Modell verständlicherweise kein Platz. Schon allein deswegen nicht, weil der Begriff Klasse die soziale Herkunft des Einzelnen und die damit verbundenen Erfahrungen von Marginalisierung oder Privilegierung betont. Klasse beharrt darauf, dass sich die gesellschaftlichen Unterschiede und Ungleichheiten in den Leben der Menschen abbilden, in den Familien, in den Bildungs- und Berufsbiographien, nicht zuletzt in Fragen der Gesundheit und Lebenserwartung. Aber all diese Unterschiede sind, so will es die große Erzählung der marktkonformen Demokratie, durch eigene Anstrengungen überwindbar oder selbst verschuldet. Wer nicht richtig arbeitet, faul ist, auf die falsche Ausbildung setzt, die falschen Freunde oder den falschen Nachnamen hat, der findet sich dann eben im unteren Segment der Gesellschaft wieder. Pech gehabt.
Dass es mit dieser Erzählung nicht weit her ist, dokumentieren seit einigen Jahren nicht nur wissenschaftliche Untersuchungen, sondern vor allem literarische Erkundungen jener gesellschaftlichen Ränder, in denen Armut handfeste Realität ist und von Geburt an über Aufstiegs- und Entfaltungschancen entscheidet. Diesem Komplex widmet sich jetzt eine größere Textsammlung, die schon im Titel deutlich macht, was Klasse im Zweifelsfall bedeuten kann: nämlich den ständigen Kampf um Anerkennung, Wahrnehmung und darum, ob man die Miete bezahlen oder die nächste Kredittilgung bedienen kann. Die einzelnen Beiträge des Bandes – der von Maria Barankow und Christian Baron herausgegeben wurde (letztere hatte sich bereits in seinem 2020 erschienen autobiographischen Roman Ein Mann seiner Klasse der Erfahrung von Armut und Gewalt gewidmet) – sind Expeditionen in jene gesellschaftlichen Bezirke, wo man sich mit Gelegenheitsjobs durchschlägt und auf die man immer wieder zurückzufallen scheint. Es sind sowohl erzählerisch-fiktionale wie autobiographische Erkundungen, die durch das vermeintlich klassenlose Deutschland führen und den Fokus auf jene Masse an Ausgegrenzten richtet, die seit Jahren im Wachsen begriffen ist. Die Autoren und Autorinnen nehmen dabei vor allem die eigenen Erfahrungen in den Blick, die schlecht bezahlte, abstumpfende Arbeit, die von Amtsbesuchen und finanzieller Knappheit geprägte Kindheiten, die Scham, zu ‚denen da‘ zu gehören, immer wieder die eigene Bildungsgeschichte. Letzteres kann bei Menschen, die es in der Außenwahrnehmung in die oberen Etagen des Kulturbetriebs geschafft haben, kaum verwundern. Gerade jene, die aufgrund von Bildung (oder Bildungsabschlüssen) ihren gesellschaftlichen Ort verlassen und sich auf den steinigen Weg nach ‚oben‘ machen, können ein Lied davon singen, wie sie reihenweise an gläserne Wände geknallt und beständig mit den habituellen Eigenheiten jener ‚Oberen‘ kollidiert sind.
Nicht allen Beiträgen geling es, diese Mechanismen von Klassenzugehörigkeit und sozialer Unterscheidung so transparent zu machen wie beispielsweise Arno Frank, Francis Seek, Sharon Dodua Otoo oder Martin Becker. Das schmälert aber weder den Verdienst dieser Sammlung noch deren Relevanz. Denn die zentrale Frage dieses auf dem Buchdeckel als Manifest bezeichneten Buches ist so drängend wie seit langem nicht mehr: „Warum empfinden so viele Menschen die Ungleichheit als gerecht oder zumindest unveränderbar?“ Ja, warum eigentlich?
© Manuel Förderer
Klasse und Kampf, herausgegeben von Christian Baron und Maria Barankow, Claassen Verlag, Berlin 2021, 224 Seiten, 20 Euro.