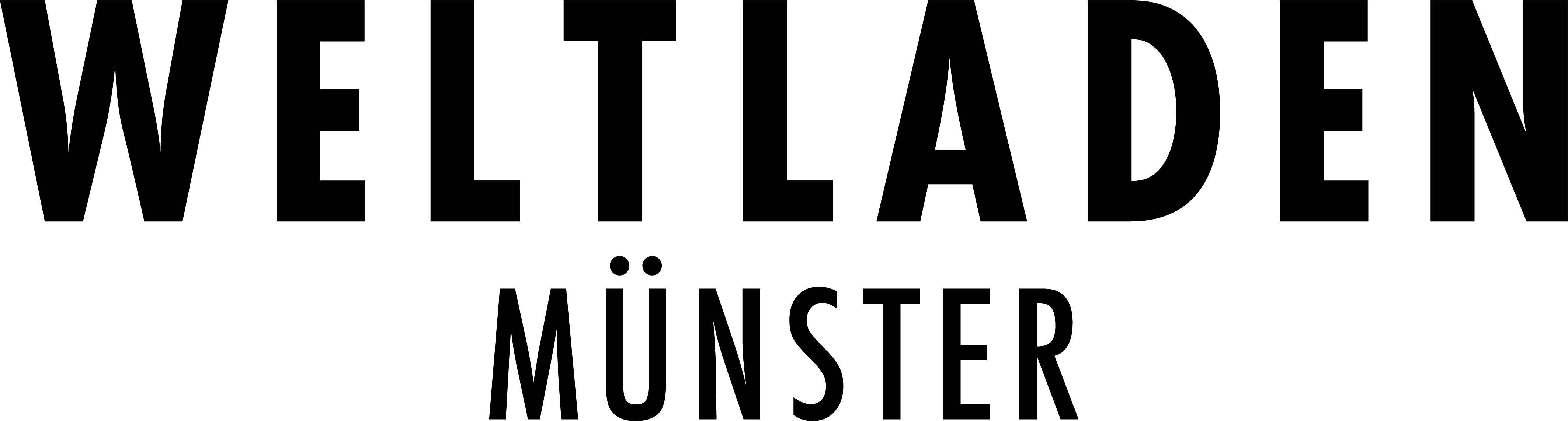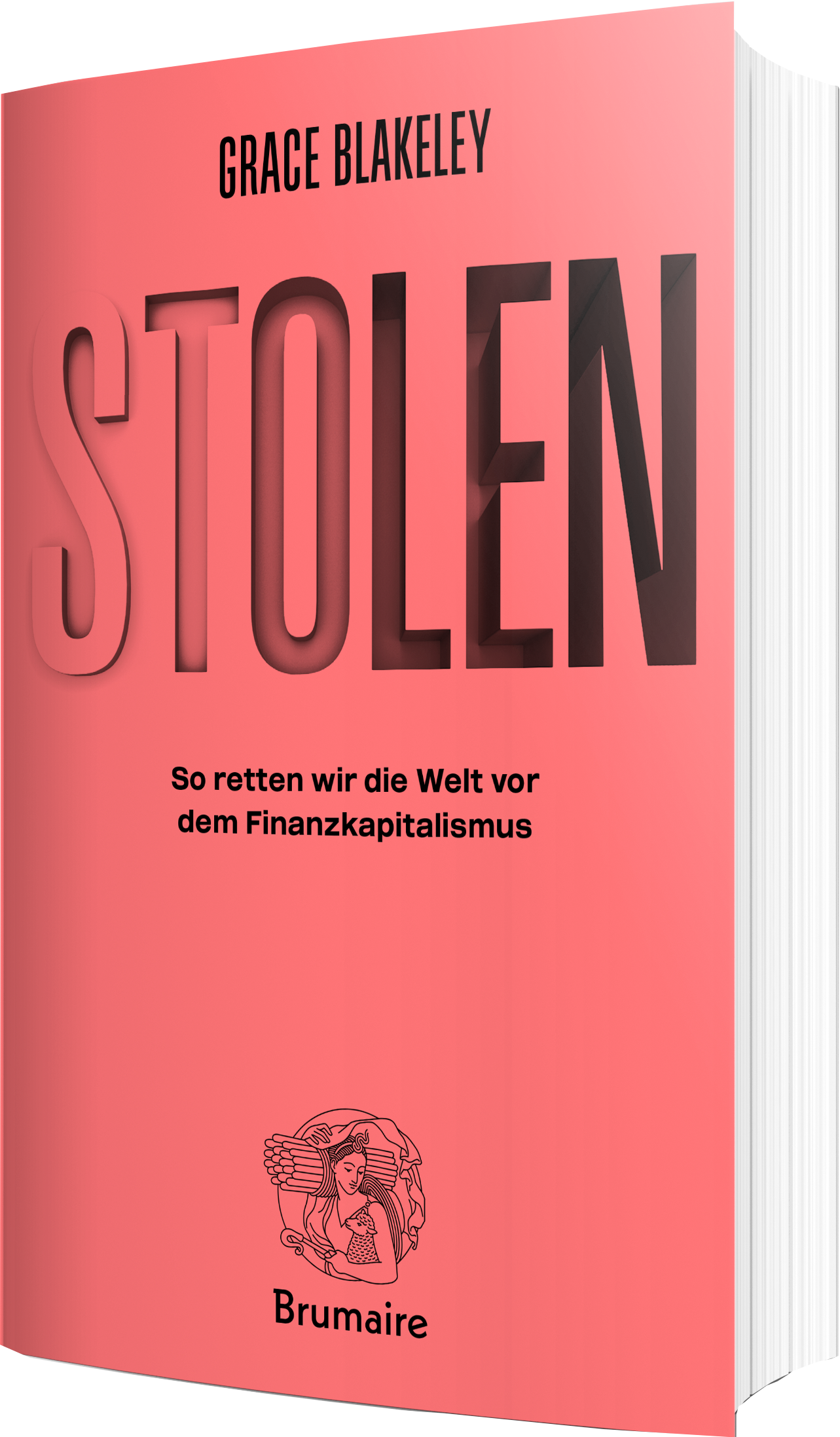
Grace Blakeley über den Neoliberalismus als polit-ökonomisches Riesenprojekt
Aktienkurs? Shareholder Value? Finanzialisierung? Kapitalmobilität? Diese Begriffe müssten eigentlich, gemessen an den gesellschaftlichen Realitäten, die sie schaffen, jedem bekannt sein – aber ein Großteil aller Deutschen dürfte wenig bis gar nichts mit ihnen anfangen können. Das liegt nicht nur an dem Sexappeal dieser Termini, der irgendwo zwischen Fußpilz und Briefmarkensammlung angesiedelt ist, sondern vor allem daran, dass er mit der Lebensrealität nahezu aller Menschen – nicht nur Deutschlands, sondern weltweit – nichts zu tun hat. Die allermeisten Deutschen besitzen keine Aktien und dürften sich ergo nur marginal für die noch immer zur besten Sendezeit über die Mattscheibe flimmernden Börsenberichte interessieren. Aber, so könnte man die Pointe von Grace Blakeleys Buch Stolen zusammenfassen, sie sollten dies tun. Denn hinter der Kakophonie finanzökonomischer Begriffsungetüme steckt ein über Jahrzehnte hinweg geradezu perfektioniertes Umverteilungsprogramm. Und damit keine Illusionen entstehen: Gemeint ist natürlich eine Umverteilung von unten nach oben.
Die junge britische Ökonomin erzählt, ausgehend von der Finanzkrise 2008/2009, die bereits ihr Landsmann John Lanchester in seinem opulenten Roman Kapital aufgegriffen hat, die Geschichte dessen, was heute als Neoliberalismus in aller Munde ist – oder eben sein sollte. Denn das, was hinter diesem Begriff steckt, ist mehr als nur ein ökonomisches Projekt, sondern ein, das wird in Blakeleys Analyse deutlich, eminent politisches. Im Zentrum stehen jene Prozesse der Finanzialisierung, die sich seit den 1970ern zunächst in Großbritannien und den USA beobachten ließen und die schließlich ihren Siegeszug über nahezu die ganze Welt angetreten haben. Während die (vermeintlich) goldene Phase des Industriekapitalismus sich durch ein stabiles Lohnniveau, eine hohe Investitionsrate der Unternehmen, hohe Spitzensteuersätze und einem kontrollierten Bankenwesen auszeichnete, war es das erklärte Ziel der Neoliberalen etwa um Ronald Reagan und Margret Thatcher, genau diese Zustände zu überwinden. Die Gründe dafür waren nicht nur extremer Geldbedarf etwa aufgrund des ruinösen Vietnamkrieges, sondern vor allem die eher bescheidenen Wachstums- und Profitraten. Und nicht zuletzt eine starke organisierte Arbeiterschafft, deren Gewerkschaften den Unternehmensleitungen die Stirn bieten konnten. Es war, wie Blakeley schreibt, dieser Nachkriegskompromiss zwischen Kapital und Arbeit, der in den 1970ern in eine Krise geriet und schließlich kollabierte.
Blakeley erzählt die Geschichte unserer ökonomischen Gegenwart spannend wie einen Krimi, dabei sachkundig und deutlich in der Wortwahl. Sie schildert, wie im Zuge des neoliberalen Umbaus der Wirtschaft (der gleichermaßen von konservativen Regierungen wie jener von Thatcher und Akteuren aus der Privatwirtschaft betrieben wurde) das Kapitel aus seiner gesetzlichen Umklammerung befreit wurde. Banken sollten selbständig Kredite vergeben (und damit Geld schöpfen) können, die Mobilität des Kapitals sollte erhöht und nicht zuletzt die organisierte Arbeiterschaft zerschlagen werden. Die Erfolge dieses Projekts sind beängstigend, denn eigentlich wurde alles erreicht. Um für dieses Projekt, das mit einer beispiellosen Bereicherung der vermögenden Klasse einherging, politische Mehrheiten zu schaffen (die durch das Agieren gegenüber den Arbeitern problematisch war), verwandelte man die Mittelschicht in eine Versammlung von Mini-Kapitalisten – und zwar, indem man ihnen den Erwerb von Immobilien ermöglichte. Der Besitz von Häusern konnte dabei nur durch eine extreme Ausweitung der privaten Verschuldung ermöglicht werden. Fortan wurden Schulden zum Schmiermittel der Weltwirtschaft – mit den bekannten Folgen.
Die Rede von der schwäbischen Hausfrau, die nur das ausgibt, was sie zur Verfügung hat, war schon immer eine ökonomische Märchenerzählung. Im Kontext des Neoliberalismus wird sie endgültig zur Farce. Das Verleihen von Geld, das Vergeben von Krediten hat sich seit den 1970er zu einem extrem lukrativen Geschäft ausgeweitet, an dem private Investoren wie Staaten gleichermaßen mitverdienen. Dabei hat sich die Finanzwirtschaft schon lange von dem heimeligen Bild des freundlichen Sparkassen-Mitarbeiters verabschiedet und sich zu einer gut geschmierten Maschinerie weiterentwickelt, die weitestgehend frei von Beschränkungen Kapital über den Erdball verschieben kann und sich zunehmend darauf spezialisiert hat, aus der epidemischen Ausweitung der Privatverschuldung Profit zu schlagen. Selbst Schulden können gebündelt und verbrieft – das heißt: in eine Ware verwandelt – werden, um sie auf den Finanzmärkten zu handeln. Produziert wird hier nichts, es werden keine realen Werte geschaffen und genau darin, so Blakeley, besteht die geradezu geniale Leistung des Kapitalismus dieser Couleur. In einer Phase mit nur geringen Profitraten schuf man die Grundlage für eine Weltwirtschaft, in der Kapitalströme sich frei bewegen, in denen Devisen frei gehandelt werden und in der große multinationale Konzerne souveräne nationale Regierungen mit der Androhung von Arbeitsplatzverlegung und Kapitelabzug erpressen können. In dieser ökonomischen Realität, in der man weltweit in Firmen investieren konnte, wurde der Aktienkurs von Unternehmen zu dem Fetisch unserer Tage, an dem sich unternehmerisches Handeln orientierte. Und das zur Freude jener Investoren, die komplett arbeitsfrei (und häufig beschämend niedrig besteuert) mitunter horrende Dividenden abgreifen konnten. Die Erträge der Arbeiterschaft wandern so in andere Taschen; dass die Vermögen in den letzten Jahrzehnten bedeutend schneller gewachsen sind als Löhne, hat zuletzt der französische Ökonom Thomas Piketty gezeigt. Das manische Stieren auf Aktienkurse ist Teil der Mechanik hinter dieser ungleichen Entwicklung, die man letztlich nur als große Bereicherung bezeichnen kann.
Ganz nebenbei verdienen Banken, Hedgefonds, Privatanleger und selbst Staaten eine zunehmend größer werdende Menge an Geld mit der gezielten Verschuldung von Bürger*innen rund um den Globus. Wenig verwunderlich ist die ökonomische und politische Macht der Vermögenden, all jener, die nicht durch Arbeit, technische Innovation oder klassische Produktion ihr Geld verdienen, enorm gestiegen. Nirgendwo zeigt sich das besser als auf dem Immobilienmarkt, wo sich etwa Vermieter seit Jahrzehnten über steigende Einnahmen freuen. Was wir seit den 1970ern beobachten durften, war das Aufkommen einer neuen Rentier-Klasse, sprich einer Gruppe an Menschen, die nur deswegen reich ist, weil sie über zumeist geerbtes Vermögen verfügt. Die altbekannte Einsicht, dass niemand durch Arbeit reich wird (sondern durch die Arbeit anderer) ist selten so deutlich bestätigt worden.
Blakeley gelingt es eindrücklich, diese Entwicklung darzulegen, die Nutznießer zu benennen und die politischen Programme hinter diesem ökonomischen Konzept herauszuarbeiten. Dagegen bleiben ihre konkreten Lösungsvorschläge, die sie am Ende ihres Buches auflistet, etwas blass – wobei man anerkennen muss, dass ihre Vorschläge sehr konkret sind, dabei aber noch einmal das finanzökonomische Wissen der Lesenden in Anspruch nimmt. Sei’s drum, wer dieses Buch gelesen hat, versteht die Gegenwart ein gutes Stück besser.
Grace Blakeley: Stolen. So retten wir die Welt vor dem Finanzkapitalismus, Verlag Brumaire, Berlin 2021, 408 Seiten, 18 Euro.
© Manuel Förderer